
Vorteile von Gentests
Warum sollte ich einen Gentest durchführen lassen?
Mehr Antworten bedeuten mehr Chancen,
deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
Gentests helfen dir dabei, fundierte Entscheidungen für deine Zukunft zu treffen.
Gentests können:
- die genetische Ursache für die Beeinträchtigung oder den Verlust deiner Sehkraft bestätigen1
- über mögliche gesundheitliche Auswirkungen auf andere Körperbereiche aufklären2
Mit einem Gentest kannst du:
- neue Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich dein Sehvermögen im Laufe der Zeit verändern könnt3
- abklären, ob du für klinische Studien und potenzielle Therapien infrage kommst4
- mögliche Risiken für weitere Familienmitglieder abwägen5
- auf Wunsch Informationen über Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen und spezielle Sehhilfen erhalten
- mit Blick auf die eigene Zukunft informiert und vorbereitet sein

Über 270 Gene
Bislang wurden über 270 Gene identifiziert, die mit erblichen Netzhauterkrankungen in Verbindung stehen. Die Ursache für deine erbliche Netzhauterkrankung kann in einem dieser Gene liegen.6
Warum sind frühzeitige Gentests wichtig?
- Je früher du einen Gentest durchführen lässt, desto eher erhältst du eine genaue Diagnose.2478
- Deine Augenärztin oder dein Augenarzt kann dir – abhängig von deinem Testergebnis – dabei helfen herauszufinden, ob es geeignete Behandlungsmöglichkeiten gibt.2478
- Ist deine genetische Ursache bekannt, erhalten auch gefährdete Familienmitglieder die Möglichkeit, einen Gentest durchführen zu lassen.2478
- Vielleicht bestätigt der Gentest bei dir eine Krankheit, die sich auch auf andere Körperbereiche auswirken kann. In diesem Fall überweist dich deine Augenärztin oder dein Augenarzt zur Behandlung an eine andere Fachärztin oder einen Facharzt.2478
- Bestimmte Therapien setzen noch lebende Zellen in der Netzhaut voraus. Da diese fortschreitend verläuft, kann eine frühzeitige Diagnose hier die Chancen auf eine erfolgreiche Therapie erhöhen.247891011
Ein Gentest kann bei bis zu 76 % der Menschen mit einer erblichen Netzhauterkrankung dabei helfen, die genetische Ursache zu identifizieren.4
Um das Gespräch mit deiner Augenärztin oder deinem Augenarzt vorzubereiten, findest du hier einige hilfreiche Fragen:
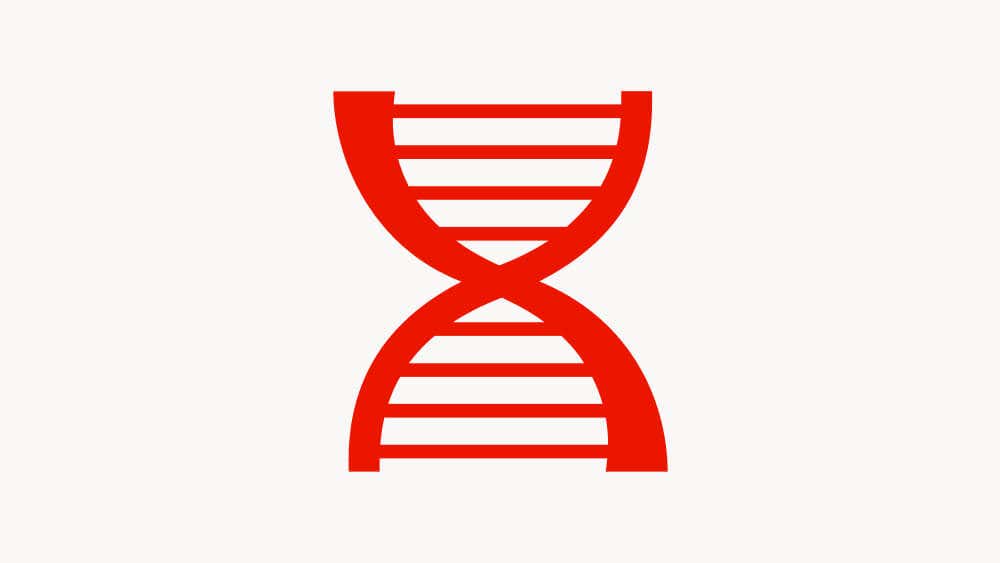
Gesprächsleitfaden für Gentest herunterladen.

Gesprächsleitfaden für die Wiederholung eines Gentests herunterladen.
„Nicht eindeutig erwiesen“ oder „Negativ“ bedeutet nicht unbedingt das Ende des Weges

- Dein Ergebnis kann deiner Augenärztin oder deinem Augenarzt Hinweise auf eine mögliche andere Diagnose liefern.51213
- Deine Augenärztin oder dein Augenarzt empfiehlt möglicherweise eine Wiederholung des Gentests in ein paar Jahren. Bedenke, dass sich die Wissenschaft weiterentwickelt und immer mehr Gene entdeckt werden.Allein in den letzten zehn Jahren wurden mehr als 100 neue Gene identifiziert, die mit erblichen Netzhauterkrankungen zusammenhängen.14
- Die Technologien für Gentests entwickeln sich weiter, mehr Labore werden eingerichtet und die Testergebnisse lassen sich besser interpretieren. So wird es in Zukunft möglich sein, bei noch mehr Menschen die genetische Ursache für die Beeinträchtigung oder den Verlust ihres Sehvermögens zu ermitteln.51213
.jpg?width=1000&height=563&format=jpg&quality=60)
Hier findest du vier einfache Schritte zum Gentest, die dir weitere Antworten liefern.

Erhalte Unterstützung durch Selbsthilfegruppen und Patienten-organisationen, die sich mit erblichen Netzhauterkrankungen beschäftigen.
Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der J&J withMe und wurde von Dr. med. Fabian Kütting, einem Mitglied unserer medizinischen Redaktionskonferenz, geprüft. Lernen Sie hier die Mitglieder unserer medizinischen Redaktionskonferenz kennen.
EM-150081